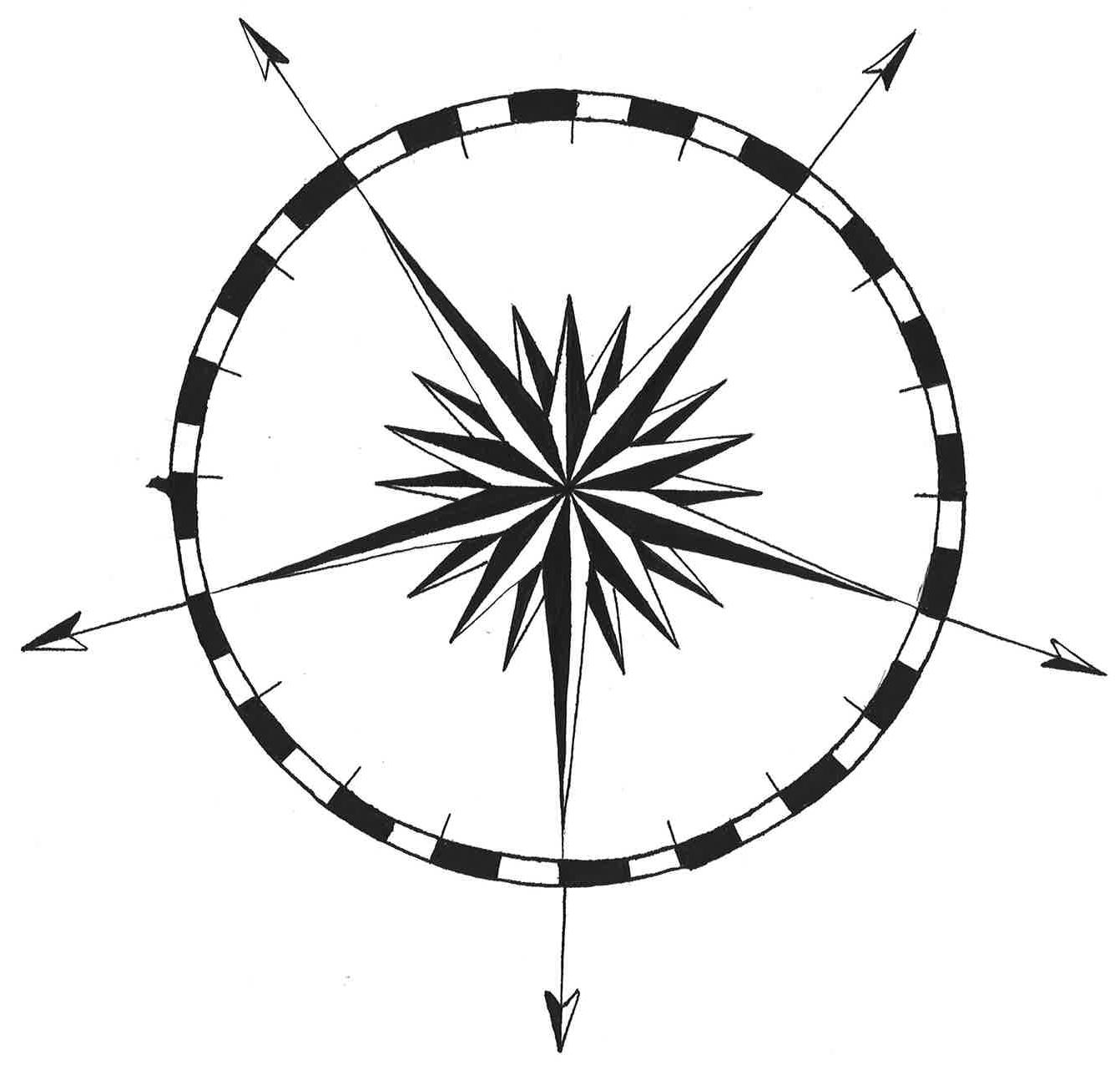Es ist 07:40 morgens. Kühles Licht fällt durch die Fenster, fällt auf müde und wache Gesichter, beleuchtet vorbeihuschende Gestalten und munter schwatzende Grüppchen und bleibt dann auf den alten Dielen liegen. Die verschiedenen Ströme von Schülern, die sich noch vor wenigen Minuten mit alltäglicher Selbstverständlichkeit aneinander vorbeischoben, sind in den Klassenzimmern verschwunden. Auch wir bahnen uns unseren Weg, nehmen im Zimmer H11 Platz und warten gemeinsam mit ungefähr fünfzehn Schülerinnen und Schülern auf Georg Geiger, Lehrer für Deutsch und Geschichte am Gymnasium Leonhard, der hier heute das Ergänzungsfach Politik und Geschichte unterrichten wird.
Es ist 07:40 morgens. Kühles Licht fällt durch die Fenster, fällt auf müde und wache Gesichter, beleuchtet vorbeihuschende Gestalten und munter schwatzende Grüppchen und bleibt dann auf den alten Dielen liegen. Die verschiedenen Ströme von Schülern, die sich noch vor wenigen Minuten mit alltäglicher Selbstverständlichkeit aneinander vorbeischoben, sind in den Klassenzimmern verschwunden. Auch wir bahnen uns unseren Weg, nehmen im Zimmer H11 Platz und warten gemeinsam mit ungefähr fünfzehn Schülerinnen und Schülern auf Georg Geiger, Lehrer für Deutsch und Geschichte am Gymnasium Leonhard, der hier heute das Ergänzungsfach Politik und Geschichte unterrichten wird.
Geiger betritt den Raum, setzt sich auf einen Stuhl, ordnet seine mit Post-It’s beklebten Notizen vor sich. Die Lektion beginnt. Er wisse noch nicht genau, was sie in diesem Jahr alles machen würden, meint er. Momentan stehen ein Besuch der Ausstellung “Europa – Die Zukunft der Geschichte” im Kunsthaus Zürich, ein Besuch im Staatsarchiv und eine Stunde mit einem in Polen arbeitenden Geschichtsstudenten auf dem Plan.
Es ist ihm ein Anliegen, nicht einfach ein Jahr lang Frontalunterricht zu machen, sondern mit den Schülerinnen und Schülern in einen ehrlichen Dialog zu treten. Diese Art von gemeinsam konzipiertem Unterricht fordere vor allem zwei Dinge von ihm, meint Geiger. Einerseits müsse er den Mut haben, Dinge auszuprobieren und im Moment auf etwas einzugehen, ohne bereits zu wissen, wohin es führe. Andererseits brauche man viel Geduld, Unsicherheiten auszuhalten und zu schauen, wie und ob sich etwas aus einem Versuch entwickelt. Im Wort Versuch steckt die Suche – ob man auf der Suche schlussendlich gemeinsam fündig wird, kann man im Vorherein nie wissen.
“Mich nimmt es dann nächste Woche Wunder, ob ihr etwas mitnehmen konntet aus dieser Europaausstellung”, meint er und lässt seinen Blick gelassen und dennoch fordernd über den Brillenrand hinweg schweifen. “Vielleicht ist diese sehr komplexe Ausstellung für einige von euch eine Überforderung. Aber – das ist auch okay. Versucht dann einfach festzuhalten, was genau euch überfordert hat. Oder was ihr inspirierend fandet. Wenn sich dann ein Abgrund von Fragen auftut, dann kümmern wir uns darum.” Dass er dieses Versprechen halten wird, glauben wir ihm, wie er uns gegenüber sitzt und in die Runde schaut.
“Als Lehrer muss ich die Spannung erzeugen und aushalten können, Dinge sehr einfach zu erklären und gleichzeitig die Schüler permanent zu überfordern”, sagt Geiger. Wenn er spricht, unterstreichen seine kräftigen, braungebrannten Hände das Gesagte, sie bannen die Wort auf den Tisch und formen die Inhalte in der Luft, wie wenn sie somit die Gedanken dingfest machen könnten. Sie scheinen unaufhörlich nach den Widerständen zu greifen, die  diese Welt zu bieten hat und Kraft daraus zu schöpfen, sich mit ihnen zu befassen.
diese Welt zu bieten hat und Kraft daraus zu schöpfen, sich mit ihnen zu befassen.
“Ich, die Schweiz und Europa” schreibt Geiger an die Wandtafel. “Verfasst bitte einen Text zu diesen drei Worten und ihrem Verhältnis zueinander. Jeder für sich allein – ich mach das jetzt auch. Gewisse Gedanken entstehen erst während des Schreibens.“ Mit diesen Worten überlässt er die Schüler ihren Gedanken. Es ist spürbar, dass in Geigers Unterricht nicht alles immer zielorientiert und zur Aufnahme von bereits bestehendem Wissen führen soll. Vielmehr sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, die Welt um sich herum wahrzunehmen und sich selbst in einen Kontext zu setzen.
Dieses “ich”, das da in energisch dichter Handschrift die Worte an der Tafel anführt, bietet die Möglichkeit, sich den geschichtlichen und politischen Zusammenhängen anhand der subjektiven Wahrnehmung zu nähern und bringt somit jeden im Raum in eine aktive Position. Es entsteht das Bewusstsein dafür, dass man selbst Teil der Ereignisse ist und – das Kunsthaus in Zürich mahnt uns daran – Einfluss auf die Zukunft der Geschichte nehmen kann.
In geduldiger Ruhe wartet Geiger, bis jemand sich dazu bereit erklärt, seinen Text vorzulesen. Die Klasse hört still zu, ob aufmerksam oder mit den Gedanken ganz woanders, ist schwer zu deuten an diesem gewöhnlichen Freitagmorgen. Es entsteht wieder ein Moment der Stille, den ich als Lehrperson wohl intuitiv zu füllen versucht hätte, doch dieser Moment hat in diesem Morgen seinen Platz – und dann, nachdem zwei weitere Texte vorgelesen wurden, entsteht doch ein immer wacher werdendes Gespräch, Fragen werden gestellt, Antworten gesucht. Dass diese drei Begriffe schwer vereinbar sind, widersprüchliche Gefühle verbinden das “ich” mit der Schweiz und Europa. Es ist allgemeiner Konsens, dass die Schweiz und Europa in einem spannungsgeladenen Verhältnis zueinander stehen. Und da sind sie, die Widerstände und Widersprüchlichkeiten, all diese Konflikte und verworrenen Zusammenhänge nach denen Geigers Hände greifen, die Halt geben können und die es nun gemeinsam zu bearbeiten gilt. Vieles bleibt ungeklärt, es sind die gewichtigen Fragen, die nicht endgültig zu beantworten sind.
verworrenen Zusammenhänge nach denen Geigers Hände greifen, die Halt geben können und die es nun gemeinsam zu bearbeiten gilt. Vieles bleibt ungeklärt, es sind die gewichtigen Fragen, die nicht endgültig zu beantworten sind.
Geiger hört zu, bringt Einwände, hakt nach – er begibt sich selbst immer wieder auf neues Terrain, um gemeinsam mit den Schülern diese Welt besser zu verstehen.
“Diese Momente gehören zu den schönsten”, meint Geiger, “die Momente, in denen gemeinsam Wissen generiert wird, das zuvor noch nicht da war. Dann existiert auch keine Hierarchie mehr, da entsteht ein dialogisches Lernen. Solche Momente kann man kultivierend erstreben, aber niemals herstellen… es sind meistens Geschenke.”
Text: Lilia Widrig
Fotos: Ivo Ludwig